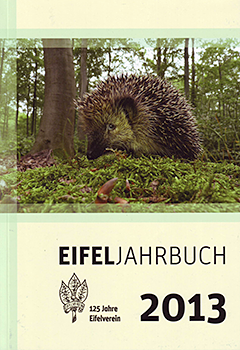 Nicht erst seitdem die Unesco den „Internationalen Tag der Muttersprache“ eingeführt hat, bedauert man auch in der Eifel und Voreifel, dass der regionale Dialekt als hiesige Umgangssprache immer mehr seine bodenständigen Bedeutung verliert. Der „TrierischeVolksfreund“ monierte in einem Artikel vom 18. Februar 2011 einen „Dialekt-Abbau“ und konstatierte: „Unser Dialekt droht auszusterben“. Drei Tage darauf wies die „Zukunftsinitiative Eifel“ unter der Überschrift „Eifeler Platt vom Aussterben bedroht“ ergänzend darauf hin, dass tatsächlich die beiden Eifeler Mundarten - das Moselfränkische und das Ripuarische (Rheinische) - auf der Roten Liste der Weltbildungsorganisation stehen.
Nicht erst seitdem die Unesco den „Internationalen Tag der Muttersprache“ eingeführt hat, bedauert man auch in der Eifel und Voreifel, dass der regionale Dialekt als hiesige Umgangssprache immer mehr seine bodenständigen Bedeutung verliert. Der „TrierischeVolksfreund“ monierte in einem Artikel vom 18. Februar 2011 einen „Dialekt-Abbau“ und konstatierte: „Unser Dialekt droht auszusterben“. Drei Tage darauf wies die „Zukunftsinitiative Eifel“ unter der Überschrift „Eifeler Platt vom Aussterben bedroht“ ergänzend darauf hin, dass tatsächlich die beiden Eifeler Mundarten - das Moselfränkische und das Ripuarische (Rheinische) - auf der Roten Liste der Weltbildungsorganisation stehen.
Somit wird erneut in der Eifel die Forderung erhoben, unsere „Regionalsprache“, den Dialekt und das Platt vor dem Vergessen zu bewahren, weil ansonsten auch das Vertraute sowie die „Nestwärme des Regionalen“ (1) verloren geht. An dieser Stelle soll nicht auf den bestehenden Unterschied zwischen Dialekt und Platt eingegangen werden, obwohl beiden vorgeworfen wird, eine „verdorbene“ Form von Sprache und ein Zeichen von Provinzialität oder gar schlechter Bildung zu sein. Dennoch sieht Karl-Heinz Göttert in dieser „Zweitsprache“ einen Vorteil im Gefühlsbereich und persönlichen Umfeld, da „man im Dialekt viel besser schimpfen kann als in der Hochsprache, in der alles geglättet wird.“ (2)
Man sollte aber nicht nur am „Gedenktag für gefährdete Sprachen“ sich darüber Gedanken machen, wie unser Sprachschatz bewahrt werden kann. Ich selber bin zudem der Ansicht, dass neben der sprachlichen Praxis und Reproduktion auch die historische Aufarbeitung des Vokabulars nicht vergessen werden sollte. Und aus ganz besonderem Grunde sollte man dann auch – und dies nicht nur in unserer Region - die deutsch-jüdische Historie berücksichtigen und diesbezüglich auch sprachliche Relikte vor dem Vergessen bewahren!
Die Ortsgruppe Euskirchen des Eifelvereins feierte im Herbst 2008 ihr 100jähriges Bestehen. Wahrscheinlich machte man sich keine Gedanken darüber, dass einst auch Juden zu den Wanderfreunden gezählt hatten. Sie wurden jedoch nicht besonders in den Ansprachen erwähnt, denn „de Jüdde jehörten dazu“. Im Fotoalbum von Martha Cleffmann geb. Schnog (1906 -1982) gibt es ein Bild aus dem Jahre 1926, das den „jüdischen Wanderverein“ von Euskirchen zeigt. (3) Eine handschriftliche Erklärung belegt, dass es sich hier um die jüdischen Mitglieder des Euskirchener Eifelvereins handelt, die sich diesmal gesondert dem Fotografen gestellt hatten. Da damals die Juden gut in unsere Gesellschaft integriert waren, sprachen und verstanden natürlich auch sie fast alle „Platt“ bzw. den Voreifeler Dialekt. Insofern kannten sie viele der sie betreffende Redewendungen, die heute verpönt sind.
Natürlich waren auch in der Eifel die Juden sowie ihr jiddisches Vokabular und ihre hebräische Ausdrucksweise ein regionaler Bestandteil der Kultur und des Zusammenlebens. Wer zum Beispiel auf dem Viehmarkt in Hillesheim oder Bitburg diesbezüglich Sprachprobleme hatte, war kein versierter Eifeler Händler. Schon damals hatte die deutsche Sprache – einschließlich des Dialektes und des Platt – viele „Hebraismen“ und „Jiddismen“ übernommen, die selbst heute noch zum gängigen Sprachschatz gehören. Ängstliche Menschen haben „Bammel“, Reiche sind „betucht“, Trinker sind „blau“ und Angeber sind „großkotzisch“. Wenn ich einem nicht ganz traue, ist derjenige mir nicht ganz „koscher“, weil er vielleicht hinter meinem Rücken „mauschelt“ oder einfach „meschugge“ ist. Aber wer weiß heute schon, dass das bekannte „at“-Zeichen (@) des Internets aus dem modernen Hebrew stammt und „Strudel“ heißt?
Ich will damit sagen, dass viele jüdische Idioms und Zeichen längst verinnerlicht sind, aber anderswo neue Begriffe weiterhin entstehen. Das gilt jedoch nur noch indirekt für die deutsche Sprache, nicht mehr für unsere regionalen Dialekte und erst recht nicht mehr für das „Eifeler Platt“! Überregional ist übrigens dasselbe festzustellen. Nur im Monschauer Bereich gab es früher wenige Redensarten dieser Art, da dort kaum Juden ansässig waren und die einzelnen Kontakte nur zu denselben jüdischen Viehhändlern bestanden. Um es noch einmal kurz zu sagen: weil es auch in der Eifel keine Juden mehr gibt, entstehen auch keine jüdischen Redensarten mehr. Das liegt vielleicht auch an der Angst, nach dem Holocaust missverstanden zu werden und versehentlich den „Wortschatz des Unmenschen“ zu benutzen. Deswegen wurden viele dieser Begriffe bewusst wegen ihrer eventuell persiflierenden Bedeutung verdrängt und sind heute beinahe ganz vergessen. Ergo: seit dem Holocaust gibt es aus diesem Grunde keine Erweiterung einer diesbezüglichen Idiomatik mehr!
Das Rheinische Wörterbuch und ganz besonders die verunglimpfende Nazipresse belegen, wie Juden unter den verschiedensten Aspekten bewertet oder gar abqualifiziert wurden. Beispiele werden diese Ansicht belegen. Einleitend soll schon darauf hingewiesen werden, dass auch der Dialekt und das Platt der Eifel grundsätzlich die Schwächen des Nachbarn kritisiert und gelegentlich verspottet. Das ist eigentlich normal und gehört seit jeher zur sozialen Kontrolle einer Gemeinschaft. Heutzutage jedoch dürfte die Kritik an ehemals jüdischen Mitbürgern der Vorkriegszeit anders gedeutet und gewertet werden. Daher hält sich der ältere Landbewohner sprachlich distanziert zurück. Das Jüdische in der Mundart retardiert dadurch und wird im Freud`schen Sinne verneint.
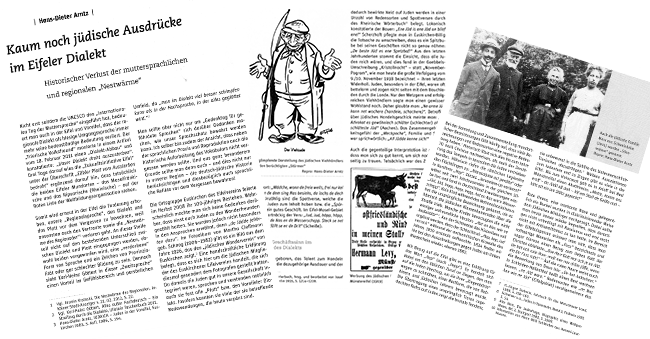
Historische Wurzeln spezifischer Ausdrücke
Die Erforschung der Dialekte und jeweiligen Mundart befasst sich schon seit jeher mit „Scheltnamen, Spitznamen, Spott- und Necknamen“. Beliebt ist auch die Freude am Wortspiel, am Reim oder Rhythmus – zum Beispiel für Zülpich „Zöllige Oellige“ oder Kommern „Kommerne Kromme“. Viele Berufe sind heute noch oder wieder in Misskredit, und daher gibt es sicher nicht wenige Menschen, die beleidigt oder durch spezielle Bezeichnungen geärgert werden. Früher wurden diese in der Sprachforschung als „Neckrufe“ bezeichnet.
Die folgenden Ausführungen tangieren Soziales, Wirtschaftliches, Kulturelles und Religiöses. Sie sind jeweils begründet durch die Zeitumstände. Wenn also zum Beispiel das Bleibergwerk in Mechernich seit seiner Schließung nicht mehr den Arbeitern als Impuls für „platte" Sprachschöpfungen dienen kann, versiegt eine diesbezügliche Quelle. Neubürger haben dort schon heute Schwierigkeiten, die Bezeichnungen „Bleiberger, Bleiköpp, Bleifüß, Kiesköpp" zu verstehen und richtig einzuordnen: Gleiches könnte auch für den Ort Voissel gelten, deren Bewohner als „Heidpicker" bekannt wurden, nämlich als „Heideschäler", die einst den Heideboden rodeten und das Material als Streu benutzten.
Gelegentlich lassen sich Juden oder jüdische Eigenschaften in Eifeler „Scheltnamen“ lokalisieren. Die Bewohner von Eicks wurden häufig als „Jüdde" bezeichnet. Angeblich handelten dort die Bauern gerne, feilschten und waren stets auf ihren Vorteil bedacht." (4) Die Formulierung: „Der handelt wie ne aahle Jüd" ist überall mit gleicher Deutung bekannt. Flamersheim, das schon immer als „Judendorf" bekannt war und diese Bezeichnung im Jahre 1984 erneut zugewiesen bekam, als ehemals hier beheimatete Juden mit ihrem Dorf ein Wiedersehen feierten (5) , war wohl wegen des florierenden Viehhandels von jeher in Richtung der Städte Köln und Bonn orientiert. Bürgerlicher Wohlstand war die Folge jüdischen Erfolges, so dass noch heute die Flamersheimer als „Windbüggel" bezeichnet werden. Die Ortschaft Kall hatte eine kleine Synagoge und wahrte von jeher die religiöse Eigenständigkeit in der dauernden Auseinandersetzung mit der orthodoxen Gemeinde Kommen und den liberaleren Juden in Gemünd und Hellenthal/Blumenthal. Dennoch gilt in manchen Kreisen der Ausdruck „Jüddscher" als Synonym für die Bevölkerung von Kall. Der Begriff ist ein Deminutivum zu Juden. In der Voreifel sind bzw. waren „Säusmajore“ Schweinehändler in „Säusheim", dem bei Flamersheim gelegenen Schweinheim. Zu ihnen zählte auch der jüdische Viehhändler Marx, der nachweislich einer der beliebtesten Bewohner war.
Bei der Sammlung und Zusammenstellung mundartlicher Bezeichnungen fällt häufig auf, dass viele Bezeichnungen und Redensarten eine negative Bedeutung haben. (6) Historisch lässt sich dies bis zum Jahre 70 nach Christus nachweisen, als nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem die Juden vertrieben wurden. Höhnisch riefen die römischen Legionäre den Flüchtlingen zu: „Hierosolyma est perdita" oder in Kurzform „Hep". Dieses „Jerusalem-ist- verloren!" währt seit zwei Jahrtausenden in der gleichen Silbe fort und fand in Deutschland Erweiterungen wie: „Jüd, Jüd, hepp, hepp, hepp, hat en Nas wie'n Wasserschepp". Kein Kind während des Nationalsozialismus hat die ursprüngliche Bezeichnung gekannt, als es hämisch die jüdischen Klassenkameraden über die Straße trieb. Manche Kinder bevorzugten die nicht weniger unfreundliche Version: „Hat en Nas wie ne Jeeßestätz" (7) . Aus der Sichtweise des Historikers soll ergänzt werden, dass der Schlachtruf: „Hep, hep, Jud verreck" während der antisemitischen Krawalle des Jahres 1819 erstmals auftauchte. 1834 finden wir ihn bei den Ausschreitungen gegen Juden am linken Niederrhein wieder, ebenso 1892.
Mit Bezug auf die Eifel gibt es eine Erklärung für das Wort „Hep" (auch „hepp"). Es handelt sich dabei um den üblichen Zuruf an Ziegen, den man auf die Juden übertrug, um sie ihrer „Ziegenbärte" wegen zu schmähen, einer Bartform, die von Rabbinern und jüdischen Lehrern bevorzugt wurde. Die Übertragung eines ursprünglich Tieren zugedachten Rufes auf Juden zeigt die brutale Tendenz, sie unbewusst in die Sphäre des Untermenschlich-Tierischen abzudrängen. (8) Weitere Assoziationen zum Judentum und zu Ziegen gibt es viele in der Eifel. Bis zum Holocaust gab es in Arloff bei Bad Münstereifel einen Abzählreim: „Motte, komm ens eraff - da Jüdd eß doh - löf em Stall de Geiße noh - hätt att ein am Stätz gepackt!"
Rote Haare, eine markante Nase und gelegentlich ein Buckel wurden in diskriminierender Weise dem jüdischen Mitbürger nachgesagt. Dabei sollte man heute immer wieder begreifen, dass derartiges nicht unbedingt mit Rassismus und erst recht nicht mit Antisemitismus zu tun hatte. Im Bereich der Eifeltalsperren erinnert man sich, dass man rothaarige Menschen als „Fuss" bezeichnete und sogar hiervon einen Bezug zum lieben Gott der Christen ableitete: „Ose Herr Gott wor och je ne Jütt. He hat och rute Hoor; moß mer nex dröm jöffe, wenn die Dir Fuss rofe!" (9)
Auf die roten Haare weist auch die Bemerkung aus Daun hin: „De hot Judashaar." In Schleiden-Hellenthal heißt einen Bart wachsen lassen: „ne Jüd were." Redensarten wie „ne Nas han wie ne Jüd" (Eifelgebiet) verallgemeinern das Sprichwort: „Mädche, wann de freie wells, frei nur kei Jud; wenn de dem sing Nas besiehs, da lachs de dech kaput!" Unzählig sind die Spottverse, die die Nase von Juden zum Inhalt haben bzw. die „Spürnase" für ein gutes Geschäft. Im Eifel-Mosel-Gebiet hält sich hartnäckig der Vers: „Jud, Jud, häpp, häpp, häpp, steck de Nas en de Wasserschepp. Steck se net te wit, dann fällt se en de Drit" (Scheiße).
Jüdischer Geschäftssinn im Vokabular des Dialekts
Das Geschäftsgebaren, das Talent zum Handeln und Feilschen, die dazugehörige Ausdauer und der dadurch bewirkte Neid auf Juden werden in einer Unzahl von Redensarten und Spottversen durch das Rheinische Wörterbuch (10) belegt. Lakonisch konstatierte der Bauer: „Ene Jüd is ene Jüd on blief ene!" Scherzhaft pflegte man in Euskirchen-Billig die Tatsache zu umschreiben, dass es ein Spitzbube bei seinen Geschäften nicht so genau nähme: „De beste Jüd es ene Spetzbof!" Aus den letzten Jahrhunderten stammt die Einsicht, dass alle Juden reich wären, und dies fand in der Goebbels-Umschreibung „Kristallnacht" - statt „November-Pogrom", wie man heute die große Verfolgung vom 9./10. November 1938 bezeichnet - ihren letzten Widerhall. Juden, besonders in der Eifel, waren oft bettelarm und zogen nicht selten mit dem Bauchladen durch die Lande. Nur den Metzgern und erfolgreichen Viehhändlern sagte man einen gewissen Wohlstand nach. Daher glaubte man: „Ne arme Jüd kann net wochere (handele, schachere)". Betroffen über jüdisches Handelsgeschick meinte man: „En Advokat es gewöhnlech schläter (schlechter) als de schläteste Jüd" (Aachen). Das Zusammengehörigkeitsgefühl der „Mechpoche", Familie und Sippe, war sprichwörtlich: „All Jüdde kenne sich!"
Auch die gegenteilige Interpretation ist möglich, dass man sich zu gut kennt, um sich noch gegenseitig zu trauen. Tatsächlich war das Zusammengehörigkeitsgefühl der Juden sehr eng, und dies wird auch heute noch bei Befragung älterer Eifeler deutlich: „Die kenne sech em Sack wie de Jüdde em Pack!"
Noch heute erinnern sich die alten Viehhändler, die bis in die Anfangsjahre des Nationalsozialismus in Hillesheim mit jüdischen Partnern zu tun hatten, wie unentwegt ein interessanter Viehverkauf fortgesetzt werden konnte. In Euskirchen hält sich bis heute die Redensart: „Du bös wie ene Jüd. We me dich an de Dür eroswerp, küste an de Poorz wedde eren!" Der einst in Strempt lebende Metzgermeister Heinrich Undorf erinnerte sich an frühere Transaktionen mit jüdischen Viehhändlern, die nicht selten gerissen und „beschasse" (betrügerisch) waren. Dabei darf man nicht vergessen, dass christliche Viehhändler oft gleiche Qualitäten hatten. Auch denen sagte man gerne nach: „De legt (lügt)" oder „flucht wie e rüde Jud" (Bitburg). Adam Wrede ergänzt in seinem Buch „Neuer Kölnischer Sprachschatz" (11) : „Frech wie ne Jüd. Du bes noch schlemmer wie ne Jüd." Jedoch ließ man auch anderen Juden Gerechtigkeit widerfahren: „Et jitt och ihrliche Jüdde, et jitt och kreßliche Jüdde!" (Köln)
Der Jude als Geldverleiher, im schlimmsten Falle als Wucherer und Schacherer, wird bereits in der Bibel ausreichend behandelt. Wenn jemand in Köln Geld aufgenommen hatte, hieß es: „Hä wor beim Jüd". Andere umschrieben dies mit: „Zum Jüd jon." Da man finanziell oft vom „Wucher-Juden" abhängig war, hieß es im ripurarischen Sprachraum: „Dat ganze Dorp hengk an de Jude" oder allgemein: „Wammer heirade well, gäht mer in de Stadt bei de Jude de Enwelligong holen" (Saarland), was nichts anderes hieß, als zur Anschaffung des bäuerlichen Inventars Geld zu leihen. Die Möglichkeit zur Teil- oder Ratenzahlung gab es in der Kreisstadt Euskirchen durch das Bekleidungsgeschäft Hanauer in der Wilhelmstraße. Schnell sprach sich herum, dass er „ein billiger Jakob" sei. Aber es hieß auch: „Dem on em aide Jud darf mer nicks schollig (schuldig) bleiwen" (Koblenz). Oft wurde die Qualität der gekauften Ware als „Ramsch" bezeichnet. Dabei war allen Käufern bekannt, dass jüdische Händler dennoch einen gewissen Gewinn machten. "Dat möt och ene schliate Jüd sen, son Sack för ne Appel un Ei ze verkofe" (Eifelgebiet). (12)
Das in den Dörfern einst so beliebte „Beiern" (Spiel der Kirchturmglocken) ist eine besondere Art des Läutens, welches durch besonders rhythmisches Anschlagen des Klöppels an die Glocken verursacht wird. Es diente früher - und nur noch gelegentlich heute - als ein festliches Läuten vor hohen Feiertagen, wie Ostern, Pfingsten, Fronleichnam. Die Bevölkerung versuchte häufig, dieses feierliche Glockengeläut zu deuten und den Tönen Wort und individuelle Bedeutung beizumessen. Ein solcher „Beierspruch" war zum Beispiel in Köln: „Alles, alles, wat mer han, hört dem Jüddchen Abraham!" (13) Der jüdische Kornhändler Emil Herz (1883-1942) aus Flamersheim, der derartiges eifrig sammelte, verstand es, in bewundernswerter Form den erwähnten „Beierspruch“ mit rhythmischen Bewegungen vorzutragen.
Trotz oft kritisiertem Geschäftsgebaren war man sich in einem einig: die Juden halten zusammen und finden in ihrem Glauben Stärke und Eintracht! Das war in der Eifel ebenso und wird in ripuarischer Mundart so ausgedrückt: „We sich met dene Judde afgit, de hat och met viele andere ze donn." Die Redensart in Hellenthal und Blumenthal, wo es um die Jahrhundertwende sogar 11% Juden in der dörflichen Bevölkerung gab, hieß kurz und bündig: „De Juderei hale", was nichts anderes bedeutete, als dass Juden ihre jüdischen Religionsgesetze stets einhalten und ihr Zusammengehörigkeitsgefühl pflegen...
Die sprachliche Entwicklung bis zum Dritten Reich
Man kannte auch den jüdischen „Schabbes", probierte „Matzen" und kleine Kinder sorgten sogar dafür, dass am Sabbath den Juden das Feuer in der Küche angezündet wurde. Eifeler Bauern respektierten bis zur Zeit des Nationalsozialismus das Anderssein ihrer Nachbarn, war dies doch schon seit Jahrhunderten bekannt. Auch in Blumenthal gab es „ne Jüddeschuel", aber die fremdländisch wirkende Liturgie wurde auch hier von keinem verstanden. Das Stimmengewirr klang über die Dorfstraße. Jedem war bekannt, dass am Samstag die Familien Rothschild, Haas, Katz oder Kaufmann in der „Jüddekerch" waren und beteten. Das Stimmengewirr wurde überall einseitig interpretiert: „Wat e Rament! Me mengt jo, me wür een en Jüddeschuel" oder „dat es hei wie een en Jüddesinajueg" (Aachen). (14)
Je mehr man in die Eifel kam, die zumindest bis zum Ende des 19. Jahrhunderts noch als „Sibirien Deutschlands" bezeichnet wurde (15) und auch der Allgemeinbildung nicht unbedingt teilhaftig war, desto weniger verstand man die religiösen Zusammenhänge der fremd erscheinenden jüdischen Liturgie, die vielen Verbeugungen vor der Thorarolle, die orientalischen „Gesänge" und die fremde „Gebetskleidung". Daher häuften sich auch in der Eifel die Interpretationen und Verfremdungen jüdischer Gebete. Im Voreifel-Bereich Meckenheim-Rheinbach entdeckten die Mitarbeiter des Rheinischen Wörterbuches in den 1930er Jahren: „Benedicks, benedacks, möt dem Beiel on möt de Ax" oder „Vatter onser, dibbedipp, dat ös David, David ös Nettekett, Nettekett ös Jöddegebett, Jöddegebett ös Mauschel, Mauschel ös Kauschel, Kauschel ös amen!" (16) Für den Bereich Trier-Schleiden galt auch: „Vater unser, der du bist, weisst du net, wo Moses ist; Moses sitzt im Kellerloch, hat Suppe net gekocht, keklos, amen!"
Wenn man bis zu dieser Stelle ein Zwischenergebnis formulieren möchte, so muss gesagt werden, dass insgesamt positive Wendungen und Redensarten selten zu finden waren bzw. sind. Dabei muss aber zweierlei in Rechnung gestellt werden. Der Vorrat an Schelten, abwertenden Reden und Spott ist in allen Mundarten merklich größer als alles Positive und Auszeichnende. Das gehört offenbar zu den Dingen, über die man schweigt, nichts sagt oder für selbstverständlich hält. Der Blick für Schwächen und die Neigung zu abwertenden Vorurteilen ist immer groß. Bei Spottversen auf Juden als Religionsgemeinschaft muss zudem bedacht werden, dass es teilweise dieselben Verse sind, die es auch unter den christlichen Konfessionen gibt: Lutherische auf Reformierte, Reformierte auf Lutherische, Katholische auf Protestanten... In diesem Sinne muss die Verunglimpfung der jüdischen Liturgie durch Bewohner des gesamten Eifelbereichs verstanden werden: „Jude, Jude, kahle Kopp, der Düvel es dinge Herregott, der Düvel singe Schwanz es dinge Rusekranz!" Im Kreis Daun fand man den Spottvers: „Die Sau, die het en kromme Rock, dat es dem Jud sein Himmelsbröck; die Sau, die heten lange Schwanz, dat es dem Jud sein Rusekranz." (17)
Die „Dürener Geschichtsblätter" des Jahres 1986 hielten folgende peinliche Episode fest:
„Isaak Meyer war übrigens im Geyer Turnverein Kassierer. Bei einem Fest ging er mit zum üblichen Kirchgang in die katholische Kirche. Zum Ende des Gottesdienstes wurde, ob bewusst oder unbewusst, das Schlusslied einer Singmesse gespielt und gesungen mit dem Text: ,Nun Isaak ist geschlachtet, das Opfer ist vollbracht!' Daraufhin hat Isaak seinen Posten niedergelegt und gesagt, er würde nie mehr zu einem Gottesdienst in diese Kirche gehen. Ich erinnere mich, dass zu meiner Schulzeit für unsere Pfarre vom Lehrer Erkens, der Organistendienst versah, dieser Text abgeändert wurde. Er lautete jetzt: Nun ist das Lamm geschlachtet!" (18)
Schnell kann somit der Verdacht bestätigt werden, dass keineswegs nur Juden sprachlich belästigt wurden. Ein Spottvers aus dem Bereich Düren bis Köln schließt nämlich Rothaarige („Fuss“) und Geistliche mit ein: „Trau kenem Jüd op sengen Ed (Eid), kenem Fuss op der Hed (Heide), kenem Pfaff op si Gewesse, söns bes du van alle drei beschesse!" Dieselbe Thematik bestätigt sich im Bereich Simmern-Schlierscheid: „Wer neist hat ze schaffe, fang an mit Jure (Juden), Hure orer Pfaffe!" Bösartig wird der Volksmund, wenn er Juden verunglimpft, ihnen Ritualmord, Bedrohung oder perverse Sexualität nachsagt.
An der Mosel ist das Lied bekannt: „Herrgottsdierchen, flie fort, sust kommen die Juden und schiessen dich dot!" In Bitburg wurde in den 1930er Jahren durch Mitarbeiter des Rheinischen Wörterbuches festgehalten: „Juden mat Stangen, welle meich un deich erhangen!" (19) Selbst Kinder werden durch den „bösen Juden" erschreckt, der somit dem „Buhmann“, dem „Hans Muff“, dem berüchtigten „Kohlenklau" der 1940er Jahre, oder dem Knecht Ruprecht entspricht. Adam Wrede schreibt: „ Andere, die nahe an den Dorfteich treten, zieht der Wassermann hinein. Schreihälse aber holt der Wolf oder der Jude mit dem großen Sack." (20)
Ungehorsame Kinder versuchte man oft durch Drohungen einzuschüchtern oder abzuschrecken. Man sagte ihnen: „Ech verkofen dech ane (an einen) Jud, da jet (wird) Boatseef aus dir jemaach" (Kreis Prüm). In der Heimbacher Gegend hieß es ähnlich: „ Do wit schwatze Seef van dir jemaat". (21) Wenn man in diesem Zusammenhang an spätere Behauptungen aus der Zeit des Holocaust denkt, kann man diese Redensarten aus der Zeit der Wende zum 20. Jahrhundert nur mit Schrecken konstatieren.
Im Jülicher Land wurde der jüdische Mitbürger fast mit dem Teufel gleichgesetzt. Hier musste nämlich der Verkäufer von Vieh, gewöhnlich ein Jude, dem Käufer ein kleines Geldstück, meist zehn Pfennige, geben, das dann von dem Käufer in der Kirche in den Klingelbeutel geworfen oder einem Armen gereicht wurde, damit das Vieh gut gedeihe. Sonst wäre das Tier angeblich verhext worden! (22) Dass die katholische Kirche in der Vergangenheit das Judentum diffamierte und drangsalierte, ist bekannt. In der Mundart der Eifel heißt dies: „Jüdde, das sind Render, fräte äwer Krestekender, schniede enne de Hals af, dat verdammte Jüddepack!"
So ist es nicht verwunderlich, dass in manchen christlichen Gemeinden - zumindest bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts - Riten entstanden, die die jüdischen Mitbürger zum Außenseiter, zum Feind stempelten, vor dem nur die Kirche schützen kann. In diesem Zusammenhang sei an die Hexenverfolgung des späten Mittelalters erinnert, die besonders in der Eifel traurige Triumphe feierte. (23) Nach Adam Wrede scheint bei der Auferstehungsfeier früher eine Verhöhnung der Juden in sinnbildlicher Form üblich gewesen zu sein. Wahrscheinlich noch heute heißt es am Niederrhein, es würden bei der Feier „de Jüdde uut de Kerek gedrieve". Nach mündlicher Überlieferung wurden beim Umzug um die Kirche sogar Steine nach den Haustüren der anliegenden Häuser geworfen. (24)
Im sexuellen Bereich spielen nicht nur Farbige, sondern auch Juden eine nicht uninteressante Rolle. Der Eifeler Volksmund kanalisiert dies in der Angst, dass einheimische Mädchen und Frauen untreu werden könnten. Insofern spielt auch das Platt eine soziale Funktion, es warnt und sanktioniert in verbaler Form. Im Rheinland heißt es: „Do kom ene Jüd van Oke (Aachen), de woll bei Trina schloape; Trina, Trina, donn et net, de Jüd, de dög (taugt) net!" Oder ähnliches aus Saarbrücken: „Gret, Gret, Gret, heirat nour kei Jud, wenn er dich geheirat hat, schleht er dich kaput." Aus der gleichen Gegend stammt die Redensart: „Made, won de heirate wellscht, heirat ka Jud; wonn de dem sei Bibbel (Penis) siescht, lachscht dich halb kabut!" (25)
Wer die zeitgenössischen Redensarten unserer „mundartlichen Vergangenheit“ verantwortlich aufarbeitet oder wissenschaftlich archiviert, darf nicht verheimlichen, dass auch der Eifeler Dialekt und sein Platt im Dritten Reich um die bekannte rassistische und antisemitische Variante erweitert wurde. Die regelmäßig erscheinende Kolumne „Der Eifelbauer sagt“ publizierte damals diskriminierende Eifeler Redensarten. Bei der sprachlichen Aufarbeitung unserer jüngsten Geschichte dürfen sie jedoch nicht verdrängt werden. Allerdings sollte man heute berücksichtigen, dass die nationalsozialistische Presse bewusst provokant war und die Mundart hierfür manipulierte und missbrauchte. Keineswegs war das idiomatische Repertoire des „Westdeutschen Beobachters“ repräsentativ für die in dieser Hinsicht tatsächlich „platte“ Sprache des Eifelbauern!
Am 7. Mai 1935 hieß es da im Lokalteil Schleiden: „ Ne Stohl, wo ne Jödd drob jeseyße hät, stenkt noch vierzehn Daag, wenn du e net met schwazzer Seyf avschrubbs“ (Ein Stuhl, auf dem ein Jude gesessen hat, stinkt noch nach vierzehn Tagen, wenn du ihn nicht mit schwarzer Seife reinigst). Ein weiteres Beispiel : „Wenn ne Jödd dir de Hangk jett, beß de ald betrouge.“ (Wenn ein Jude dir die Hand gibt, bist du schon betrogen). Dieselbe Thematik gab es auch in Reimform: „Kött ne Jödd en deng Huus,dann flügh dr Fredde met dem Jeld erus“ (Kommt ein Jude in dein Haus, fliegt der Friede mit dem Geld heraus).
Das Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 als „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ wurde auch in der NS-Presse systematisch vorbereitet. Die Schleidener - und etwas später die Monschauer - Redakteure publizierten unauffällig eine moralische Direktive am 9. Mai 1935, die sie den platt sprechenden Eifelbauern in den Mund legten: „E dütsch Mädche, wat sech vun nem Jödde-Dokter ongersöke löt, es net weät, dat et von enm Jong ajekek wied.“ Selbst wenn in anderen Eifelregionen die Formulierung und das Vokabular abweicht, so soll dies wohl heißen: „Ein deutsches Mädchen, das sich von einem Juden-Doktor untersuchen lässt, ist es nicht wert, von einem Jungen angesehen zu werden.“ Die Nürnberger Rassegesetze bestimmten u. a., dass Juden nicht mehr deutsche Reichsbürger, sondern „Staatsangehörige“ seien. Der „Westdeutsche Beobachter“ betonte im Dialekt diese Auffassung vom Deutschtum: „ Weä ne Jödd jett verdeene löt, es net weärt, dat heä en Dütschland leäv.“ (Wer einen Juden etwas verdienen lässt, ist es nicht wert, dass er in Deutschland lebt)
Absichtlich wurde in der vorliegenden Darstellung nicht mehr auf das „Jiddisch", das Hausierer-Rotwelsch und ähnliches eingegangen, obwohl dies ergänzende Faktoren wären. Es wurde bereits an anderer Stelle getan. (26) Dennoch sei darauf hinzuweisen, dass J. B. Weber 1921 in Trier die Schrift „ Die Geheimsprache der Handelsleute" für den Raum der Eifel herausgegeben hat (27) , um das „Judendeutsch" von Viehhändlern, Metzgern und Maklern darzustellen. In der Einleitung heißt es: „ (…) Wie oft kommt es vor, dass die Handelsleute beim Abschluss der Geschäfte unter sich `mauscheln', während der Dritte, um dessen Geld oder Ware sich das Geschäft dreht, zwar mit offenen Ohren zuhört, aber nur rätselhafte Laute vernimmt! Und von welch großem Vorteil könnte es für ihn sein, wenn er mit den Geheimnissen der Mauschelsprache' vertraut wäre (…)".
Unverstande jüdischen Riten in den Resten des Eifeler Idiomatik
Völlig vertraut mit jüdischen Riten und Bräuchen wurde auch die Bevölkerung der Eifel nicht. Diese blieben in letzter Konsequenz stets unverstanden. Mit dem Nationalsozialismus kam zudem eine neue Didaktik und Semantik auf, die besonders das Negativbild vom deutschen Juden ausbaute. Der Autor versuchte dies detailliert in seinem Buch „JUDAICA - Juden in der Voreifel" nachzuzeichnen. (28) Es bleibt die Frage offen, inwieweit auch der Dialekt sowie das Platt der Eifel mit seinen anti-jüdischen Redensarten eine Haltung vorbereitete, die später Geschehenes möglich machte.
Heute gibt es nur noch wenige Juden in der Eifel. Friedhöfe sind oft die letzten Erinnerungen an einst blühende jüdische Synagogengemeinden. Aber selbst den Tod eines jüdischen Mitbürgers und die Gestaltung des Grabes haben viele bis heute nicht verstanden. Jüdische Grabpflege hat ihre besondere Form. Seit dem Mittelalter sind Blumen als Grabschmuck verpönt, weil es ein nicht-jüdischer Brauch ist. In talmudischen Zeiten hat man, so wird erzählt, wohlriechende Kräuter und dergleichen dem Toten bei der Beerdigung beigegeben. Die Feier auf dem „Jüddekerchef" war schmucklos, zumal der Verstorbene in einer Holzkiste und nicht in einem prachtvollen Sarg seine letzte Ruhestätte findet. Christen waren nur selten anwesend. Wie sich dann die Eifeler Redensart entwickelte, die beim Stolpern über einen Stein folgte: „Aid widder ene Jüd begrave“ (Schon wieder ein Jude begraben), bleibt unklar. Auch der Tod eines unbeliebten Mitbürgers findet eine Formulierung, die für einen Juden nichts Positives ausdrückt: „Dat däht mer kam (keinem) Juden wönschen!" (Bitburg). Unklar und durchaus diskussionsbedürftig bleibt auch die Schleidener Formulierung: „Die Lamp brennt, als wenn eine Jüd am harschte war" oder die aus Düren: „Häs du net gesehn dem ale Jüd sen Ben; häsde net gerouche dem ale Jüd seng Knouche?"
Nur noch wenige mundartliche Redensarten im Dialekt und Platt der Eifel und einige jüdische Begräbnisplätze erinnern an das Judentum der Region. Beim Betreten der schmucklosen Friedhöfe, die heute unter Denkmalschutz stehen und von den jeweiligen Gemeinden gepflegt werden müssen, erinnern sich noch einige Bewohner aus Kommern an den Vers: „Wenn de Jüd jestorwen es, dann steckt man se en de Eierkeß!" (29)
Zur Aufarbeitung der Vergangenheit gehört auch die Erinnerung an sprachliche Relikte, die das regionale Judentum beinhalten. Sie sind nicht nur ein wichtiges regionalhistorisches Überbleibsel des allmählich verschwindenden Eifeler Dialekts, sondern erinnern auch an das einstige Miteinander von Juden und Christen.
(1) Vgl. Jasmin Krsteski, Die Nestwärme des Regionalen, in: Kölner Stadt-Anzeiger v. 21. 02. 2012, S. 22.
(2) Vgl. Karl-Heinz Göttert, Alles außer Hochdeutsch – Ein Streifzug durch die Dialekte, Ullstein Taschenbuch
2011.
(4) Vgl. Artikel der israelischen Zeitung Haaretz, How German built the Hebrew language, in: The Jewishgen
Bulletin Gersig vom 18. Februar 2010.
(5) Hans Hardenberg, Necknamen und Neckverse aus dem Raum Euskirchen, in: 100 Jahre Emil-Fischer-
Gymnasium, Euskirchen 1951, S. 167.
(11) Rheinisches Wörterbuch, hrsg. und bearbeitet von Josef Müller, Bd. 3, Berlin 1935, S. 1214-1228.
(19) Josef Koller, Über die Juden in Gey im 20. Jahrhundert, in: Dürener Geschichtsblätter Nr. 75,1986.
(22) Adam Wrede, Eifeler Volkskunde, Bonn/Leipzig 1924, S. 142. Vgl. auch Josef Müller, Judenspott in
rheinischen Neckrufen, in: Zeitschrift für rheinische und westfälische Volkskunde Nr. 16, S.22-29 (1919)
und Peter Wimmert, Scherzreime aus dem Volksmund, in: Eifeler Mundart,Zeitschrift für deutsche
Mundarten, 1909, S.172-173.
(23) Vgl. Anm. 21, S.215, aber auch: Monatszeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Nr. 21,
S. 87-89 (-61914).
(24) Hans-Dieter Arntz, , Hexenwahn wie eine Epidemie, in: Jahrbuch des Kreises Euskirchen 1979, S. 71-77.
(25) Vgl. Anm. 21, S.259. Weiterhin schreibt auch Heinrich Schrörs, über den Ausdruck „ex terminium
Judaeorum" in: Religiöse Gebräuche in der alten Erzdiözese Köln. Ihre Ausartung und Bekämpfung im
17./18. Jahrhundert. In: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 82, S. 156, Fußnoten 5 und
168 im Nachtrag.
(27) Alois Mertes, Neroth - eine Fundgrube der Wirtschafts- und Sprachgeschichte, in: Eifeljahrbuch 1983, S.
133, sowie Fußnoten auf S. 137.
(28) J. B. Weber, Die Geheimnisse der Handelsleute. Hrsg. vom Justitiar des Trierischen Bauernvereins und
seiner Töchterorganisationen, Trier 1921, 2. Aufl., 1924.
(30) Hans-Dieter Arntz, JUDAICA, a. a. O. Kapitel 20: Die Euskirchener Presse im Kampf gegen das Judentum, S.
187-206. Vgl. weiterhin: Sabine Etzold, Heißt Trompetenschleim und kommt aus Galizien. Wie man Juden
mit den Namen die Ehre nahm. In: Beilage zum „Kölner Stadt-Anzeiger" vom 11 ./12. Juli 1987. Zudem:
Alan Dundes, u. a.: Kennt der Witz kein Tabu? Zynische Erzählform als Versuch der Bewältigung
nationalsozialistischer Verbrechen. In: Zeitschrift für Volkskunde, 83. Jg. 1987,1. Halbjahresband, S. 1-20.